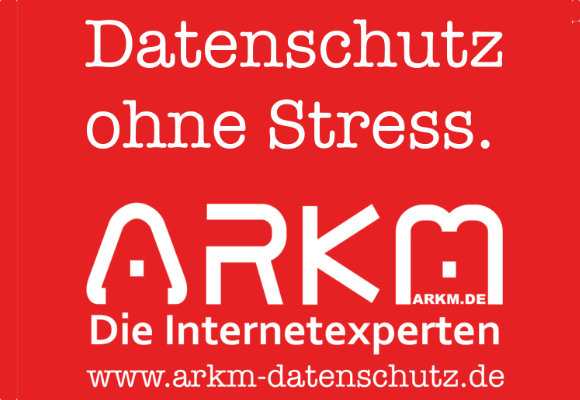Führung in der VUCA-Welt. Warum klassische Konzepte nicht mehr greifen
Gastartikel von Kathrin Krügel

Die Anforderungen an Führungskräfte haben sich in den letzten Jahren nicht nur schrittweise, sondern in vielen Bereichen radikal verändert. Was früher als stabil galt, wird heute in Frage gestellt, oft innerhalb weniger Monate. Viele Führungskräfte berichten, dass ihr Arbeitsalltag dichter, schneller und unvorhersehbarer geworden ist als je zuvor. Entscheidungen müssen unter Zeitdruck getroffen werden, häufig auf Basis unvollständiger oder widersprüchlicher Informationen. Strategien, die gestern noch Gültigkeit hatten, verlieren heute schon an Relevanz.
Hinzu kommt, dass Teams zunehmend dezentral arbeiten, oft über mehrere Zeitzonen hinweg. Kommunikation verlagert sich auf eine Vielzahl von Kanälen von Video-Calls über Projektmanagement-Tools bis hin zu Chat-Apps und muss ständig angepasst werden. Technologische Entwicklungen, Automatisierung und künstliche Intelligenz schaffen einerseits neue Chancen, unterbrechen andererseits aber eingespielte Routinen. Wer heute führt, bewegt sich in einem dynamischen System, das sich permanent selbst hinterfragt.
VUCA – vier Buchstaben, die vieles erklären
Der Begriff VUCA hat sich als nützliches Modell etabliert, um diese Veränderungen zu beschreiben. Die vier Buchstaben stehen für Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit. Diese Phänomene sind in der heutigen Führungsrealität allgegenwärtig und sie wirken oft gleichzeitig.
Auch wenn VUCA ursprünglich aus den 1990er-Jahren stammt, ist es heute aktueller denn je. Der entscheidende Unterschied zu früher liegt nicht nur in der Beschleunigung des Wandels, sondern auch in den Erwartungen an den Umgang damit. Früher galt es als Kernaufgabe von Führung, Klarheit, Antworten und Stabilität zu bieten. Heute rückt die Fähigkeit in den Vordergrund, Unsicherheit bewusst anzunehmen und mit ihr zu arbeiten, statt sie zu verdrängen oder zu bekämpfen.
Beispielsweise kann eine Produktstrategie heute nicht mehr in Fünfjahresplänen starr festgelegt werden, zu schnell verändern sich Märkte, Technologien und Kundenbedürfnisse. Stattdessen müssen Führungskräfte Szenarien denken, Spielräume lassen und flexibel Kursanpassungen vornehmen können.
Führung neu verstehen
Führung bedeutet in dieser Realität nicht mehr, die perfekte Lösung zu kennen. Es geht vielmehr darum, mit Ambivalenz zu leben, handlungsfähig zu bleiben, auch wenn nicht alle Informationen vorliegen, und die eigenen Werte als Kompass zu nutzen.
Viele Führungskräfte stellen sich deshalb Fragen wie:
- Wie kann ich Orientierung geben, wenn ich selbst nicht alle Antworten habe
- Wie balanciere ich die Bedürfnisse des Unternehmens mit den individuellen Bedürfnissen meines Teams
- Wie bleibe ich präsent und wirksam, ohne mich in ständiger Erreichbarkeit zu verlieren
Die Antworten darauf sind selten einfach. Sie erfordern Reflexion, die Bereitschaft zur kontinuierlichen Neuausrichtung und den Mut, nicht immer vollständig zu sein. Gute Führung entsteht heute weniger durch starre Prozesse, sondern durch Beweglichkeit im Denken, Vertrauen in Beziehungen und die Bereitschaft, Entscheidungen auch unter Unsicherheit zu treffen.
Resilienz als Führungsqualität
In der VUCA-Welt erweist sich Resilienz als eine der wichtigsten Eigenschaften. Sie bedeutet nicht nur Durchhaltevermögen, sondern auch die Fähigkeit, flexibel zu reagieren, eigene Ressourcen zu aktivieren und aus Herausforderungen zu lernen.
Resiliente Führung heißt, die Unsicherheit nicht als Gegner, sondern als Gesprächspartner zu begreifen. Sie ernst zu nehmen, ohne ihr die Macht zu geben, das Handeln zu blockieren. Wer resiliente Strukturen im Team aufbaut, etwa durch klare Prioritäten, regelmäßige Reflexionsrunden und psychologische Sicherheit, schafft eine Grundlage, auf der selbst in turbulenten Zeiten Fortschritt möglich ist.
Ein Beispiel: Anstatt in einer Krise alle Entscheidungen an sich zu ziehen, teilt eine resiliente Führungskraft Verantwortung bewusst im Team, um kollektive Intelligenz zu nutzen und Druck auf mehrere Schultern zu verteilen.
Neue Maßstäbe für Wirksamkeit
Auch das Verständnis von Erfolg verändert sich. Neben klassischen Kennzahlen zählt zunehmend die Fähigkeit, ein Umfeld zu schaffen, in dem Mitarbeitende mitdenken, mittragen und mitgestalten. Kontrolle und starre Steuerung treten in den Hintergrund. Stattdessen gewinnen Vertrauen, Sinn und Beteiligung an Bedeutung.
Mitarbeitende wollen heute verstehen, warum sie etwas tun, welchen Beitrag ihre Arbeit leistet und wie sich ihre Ergebnisse auswirken. Sie wünschen sich Mitsprache, Partizipation und echte Wertschätzung.
Für Führungskräfte bedeutet das: weniger Mikromanagement, mehr Eigenverantwortung. An die Stelle von detaillierten Anweisungen treten klare Ziele, gemeinsam definierte Leitlinien und die Einladung, Verantwortung zu übernehmen.
Räume schaffen statt alles im Blick haben
Dieser Wandel erfordert oft einen Rollenwechsel. Statt alles selbst im Blick haben zu müssen, besteht die Führungsaufgabe zunehmend darin, Räume für Eigenverantwortung und Innovation zu schaffen.
Das kann bedeuten, bewusst Raum für Experimente zu lassen, Fehler nicht nur zu tolerieren, sondern als Lernchancen zu sehen, und sich als Moderatorin oder Moderator zu verstehen, der den Rahmen setzt, innerhalb dessen Teams sich entfalten können.
Orientierung entsteht dabei weniger durch detaillierte Pläne, sondern durch eine klare Vision, einen fortlaufenden Dialog und spürbare Präsenz der Führungskraft.
Ein anderes Tempo zulassen
Die VUCA-Welt suggeriert oft, dass alles immer schneller gehen muss. Doch nachhaltige Führung bedeutet, bewusst auch zu verlangsamen. Statt in Dauerreaktivität zu verfallen, gilt es, Prioritäten klar zu setzen, Fokus zu bewahren und Ressourcen sinnvoll einzusetzen.
Manchmal ist es wirksamer, innezuhalten, statt sofort zu handeln. Gespräche tiefer zu führen, statt sie oberflächlich abzuhaken. Strategien bewusst iterativ zu entwickeln, statt alles auf einmal zu planen. Diese Haltung schafft Qualität in der Zusammenarbeit und Resilienz im System.
Coaching als Raum für Entwicklung
Ein Business Coaching für Führungskräfte kann in dieser Welt eine wertvolle Unterstützung bieten, nicht als Quelle schneller Antworten, sondern als sicherer Raum für Reflexion und innere Klärung.
Im Coaching können Führungskräfte sich Fragen stellen wie:
- Wer bin ich als Führungskraft, wenn Planbarkeit nicht mehr gegeben ist
- Wie definiere ich Verantwortung in einem Umfeld, das ständigen Wandel erfordert
- Wo liegt meine persönliche Grenze zwischen Kontrolle und Vertrauen
Diese Arbeit an der eigenen Haltung ist ein zentraler Hebel, um in unsicheren Zeiten klar, präsent und handlungsfähig zu bleiben.
Haltung statt Position
In der VUCA-Welt gewinnt Selbstführung an Bedeutung. Sie beginnt damit, den Mut zu haben, sich mit den Fragen auseinanderzusetzen, die keine schnellen Antworten erlauben.
Wer diesen Weg geht, gewinnt oft nicht nur mehr innere Klarheit, sondern auch eine tiefere Verbindung zu sich selbst und mehr Einfluss auf das eigene Handeln, gerade dann, wenn äußere Sicherheit fehlt.
Fazit
Die VUCA-Welt stellt Führungskräfte vor enorme Herausforderungen. Gleichzeitig eröffnet sie die Chance, Führung neu zu denken: weniger als Position, mehr als Haltung, weniger als Hierarchie, mehr als Beziehung, weniger als Kontrolle, mehr als Gestaltung.
Wer bereit ist, diese Perspektive einzunehmen, kann auch in unsicheren Zeiten wirksam bleiben und ein Arbeitsumfeld schaffen, das nicht nur Ergebnisse liefert, sondern auch Sinn, Vertrauen und Entwicklung fördert.
Über die Autorin
Kathrin Krügel ist Business Coach und Managementberaterin mit über 20 Jahren internationaler Führungserfahrung. Sie unterstützt Führungskräfte und Unternehmen dabei, in einer komplexen Arbeitswelt durch psychodynamisches Coaching, emotionale Intelligenz und neurowissenschaftlich fundierte Methoden resilient und wirksam zu führen. https://refra-me.de/