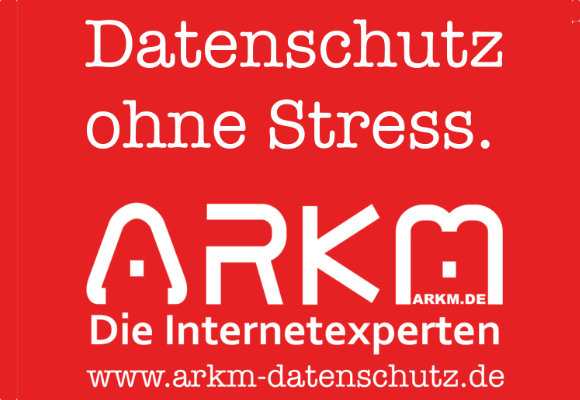Rechtliche Herausforderungen durch Künstliche Intelligenz
Wem gehört ein KI-generiertes Werk?

Die KI als „Urheber“?
Mit dem Aufstieg von Künstlicher Intelligenz (KI) – insbesondere generativer Systeme wie ChatGPT, Midjourney oder DALL·E – hat sich eine grundlegende Frage im Urheberrecht aufgedrängt: Kann ein Werk, das von einer Maschine geschaffen wurde, urheberrechtlich geschützt sein? Und wenn ja, wem gehört dieses Werk – der KI, dem Nutzer, dem Entwickler oder niemandem? Die aktuellen rechtlichen Regelungen sind auf menschliche Schöpfungen ausgerichtet und geraten zunehmend unter Druck, angesichts der technologischen Realität eine Antwort zu liefern.
Urheberrecht im klassischen Sinn: Der Mensch als Schöpfer
Nach geltendem deutschen und europäischen Urheberrecht (§ 7 UrhG) ist nur eine natürliche Person urheberrechtsfähig. Das bedeutet: Nur Menschen können Urheber im rechtlichen Sinne sein. Ein Werk entsteht durch eine „persönliche geistige Schöpfung“ – ein Begriff, der Individualität, Kreativität und Ausdruck des Menschen voraussetzt. KI-Systeme verfügen jedoch (noch) nicht über Bewusstsein, Intention oder eigene kreative Motivation – zentrale Kriterien, um ein Werk urheberrechtlich zu schützen.
Der Status quo: Keine Urheberrechte für Maschinen
Derzeit gibt es weltweit keine anerkannte rechtliche Grundlage, die einer KI Urheberrechte zuschreibt. Weder in Deutschland noch im internationalen Kontext (z. B. Berner Übereinkunft oder WIPO-Verträge) gelten Maschinen als „Rechtssubjekte“.
Das hat zur Folge:
- KI-generierte Inhalte (Texte, Bilder, Musik) sind im Zweifel nicht geschützt, wenn kein menschlicher Beitrag erkennbar ist.
- Verwertungsrechte können problematisch sein, weil unklar ist, wer sie beanspruchen darf.
Ein Beispiel: Wenn eine KI ein Bild generiert, das der Nutzer nur durch einen einfachen Prompt („Ein Hund auf dem Mars“) ausgelöst hat, fehlt meist die „persönliche geistige Schöpfung“. Ein urheberrechtlicher Schutz ist fraglich.
Wer könnte die Rechte beanspruchen?
Da KI keine Rechteinhaberin sein kann, stellt sich die Frage: Wer – wenn überhaupt – hat Rechte an einem KI-generierten Werk? Es gibt derzeit drei gängige Perspektiven:
1. Der Nutzer als Urheber?
Argument: Der Nutzer gibt der KI durch den Prompt eine kreative Richtung vor.
Problem: In vielen Fällen reicht ein einfacher Prompt nicht aus, um eine persönliche Schöpfung zu begründen. Je komplexer der Prompt und je größer der kreative Einfluss des Nutzers, desto eher ist Schutz denkbar – ähnlich einer Foto-Regie.
2. Der Entwickler der KI als Urheber?
Argument: Der Entwickler schafft das System, das kreative Leistungen ermöglicht.
Problem: Der Entwickler hat meist keinen Einfluss auf den konkreten Output, was gegen eine urheberrechtliche Zurechnung spricht.
3. Gar kein Urheberrechtsschutz?
Wenn kein menschlicher Beitrag ausreicht, könnte man argumentieren, dass KI-generierte Werke gemeinfrei sind – also von niemandem exklusiv verwertet werden dürfen. Dies wäre allerdings wirtschaftlich problematisch für Content-Produzenten und Plattformen.
Internationale Entwicklungen und Diskussionen
In den USA hat das Copyright Office mehrfach klargestellt, dass rein KI-generierte Werke nicht urheberrechtsfähig sind. Ein Beispiel: Das 2023 abgelehnte Copyright für ein KI-erstelltes Bild durch Midjourney, das ohne maßgeblichen menschlichen Einfluss entstand.
In Australien und Großbritannien gab es Debatten über „maschinelles Urheberrecht“, wobei gewisse Schutzmechanismen diskutiert wurden, etwa eine Art leistungsschutzähnliches Recht für KI-Produzenten oder Nutzer.
Die EU plant mit der KI-Verordnung (AI Act) zwar Regulierungen zur Sicherheit und Transparenz von KI-Systemen, aber keine direkte Regelung des Urheberrechts – dieses bleibt national oder durch bestehende EU-Richtlinien geregelt.
Juristische und ethische Folgefragen
Die Diskussion wirft weitere rechtliche Fragen auf:
- Haftung: Wer haftet für rechtswidrige Inhalte, die von einer KI generiert werden?
- Plagiat und Training: Darf eine KI auf urheberrechtlich geschützten Werken lernen? (z. B. bei Text- oder Bild-KIs)
- Verwertungsrechte: Dürfen Plattformen wie Adobe oder OpenAI KI-generierte Inhalte verkaufen, ohne Urheberrechte?
- Zudem entstehen ethische Konflikte: Ist es fair, dass Menschen ihre kreativen Leistungen verlieren oder verdrängt sehen, während KI-Produzenten damit Gewinne machen?
Der Rechtsrahmen hinkt der Technik hinterher
Die juristische Realität ist derzeit eindeutig: KI kann kein Urheber sein. Doch in der Praxis entstehen Millionen Werke, deren rechtlicher Status unklar ist. Der Gesetzgeber steht vor einer schwierigen Aufgabe: Er muss einerseits die Kreativität und Innovation durch KI ermöglichen, andererseits aber menschliche Kreativität und Rechte schützen. Ob dies durch neue Urheberrechtskategorien, Leistungsschutzrechte oder technische Lösungen (wie Wasserzeichenpflichten) geschehen soll, ist noch offen.
Fest steht: Das Urheberrecht steht vor einer tiefgreifenden Reform – und Künstliche Intelligenz ist ihr größter Treiber.
Quelle: ARKM Redaktion